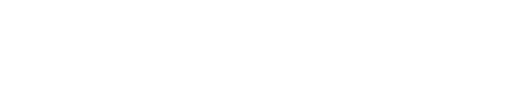Wo tut es weh?

Predigt von Br. Pascal Herold OSB am 3. Fastensonntag.
Anfang letzter Woche kam ich mit einer bekannten Frau ins Gespräch über die Pflege und Versorgung ihrer 91-jährigen Schwiegermutter. Sie erwähnte wie sich deren gesundheitliche Verfassung über Jahre kontinuierlich verschlechterte. Heute ist sie komplett auf Rundumpflege angewiesen, sie ist rollstuhlpflichtig, sehbehindert und dement. Sie erzählte auch von ihrem Freundeskreis und äußerte, dass im vergangenen Jahr ein sehr guter Freund im Alter von 61 Jahren verstorben ist. Zusammen mit anderen befreundeten Ehepaaren unternahmen sie in all den Jahren gemeinsame Wanderungen und verbrachten einmal im Jahr ein Wochenende miteinander. Vor zwei Wochen verstarb die Ehefrau des Freundes. Sie warf die Frage auf „Warum Gott diese Unverhältnismäßigkeit zulässt?“ Ihre Schwiegermutter ist ein Pflegefall und wartet nur noch auf den Tod, während das befreundete Ehepaar voll im Leben stand, sich auf den Ruhestand einrichtete und große Pläne für die Zukunft hatte.
Ist das nicht ungerecht?!, so ihre Haltung. Warum kann Gott das zulassen? Warum darf ihre Schwiegermutter nicht sterben, während der Tod dem befreundeten Ehepaar keine Wahl ließ? Warum hat sich dieses so und jenes so entwickelt? Warum ist das so? Ich kann den Unmut der Unrecht empfindenden Frau verstehen da sie die leidvolle Realität menschlicher Existenzen benennt. Das Warum kann zu einer sehr persönlichen, existentiellen Frage werden. Wie kann ich an einen Gott glauben, der Menschen unverhältnismäßig abberuft, so scheint es. Warum gerade die beiden? Haben sie etwas falsch gemacht, etwas verbrochen?
Das ist ja die Frage der Leute im heutigen Evangelium, warum ausgerechnet diese 18 Menschen ums Leben kamen beim Einsturz des Turmes am Schilóach. Wie erklären wir - analog zu dieser Schilderung gedacht - den Tod von den vielen Menschen, die in den vergangenen Wochen durch die Amokfahrten in Magdeburg, München und Mannheim unschuldig ums Leben kamen? Sie waren Unbeteiligte, waren rein zufällig auf dem Weg, befanden sich gerade an der Stelle, an der der Amokfahrer blind in die Menschenmenge fuhr.
„Meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem“, bezieht Jesus Gegenstellung zu den Getöteten von Schilóach. „Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt“. Jesus spricht sich hier entschieden gegen den Zusammenhang von Schuld und Tod, von Handlung und persönlichem Schicksalsschlag aus. Dazu verweist er gleichermaßen auf das Schicksal der galiläischen Pilger, die Pilatus als Statthalter der römischen Besatzung bei der Opferhandlung preisgegeben waren und ermordet wurden. Ihnen wird man wohl kaum ein Fehlverhalten vorwerfen können als sie ihr Opfer darbringen.
Jesus überrascht an dieser Stelle mit den Worten: „Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt“. Ihr alle, in der Verquickung von wenn ihr nicht umkehrt. Darauf zielt es Jesus ab und lenkt den Focus auf jede Person - damals, auf die Menschen seiner Zeit und auf jeden einzelnen heute, alle, die wir heute die Gemeinten sind. Wie schnell können sich aus dem Stand heraus Lebenssituationen ändern und tragisch enden, z.B. bei Unglücksfällen, Unglücken, schweren Diagnosen und anderen schicksalshaften Umständen. Innerhalb einer Sekunde kann das Blatt sich wenden ohne dass es dafür eine Erklärung gibt. Der Turm am Schilóach könnte auch uns treffen. Dabei geht es gar nicht um den Tod, sondern um unser bisheriges Leben wie wir es gelebt haben, um unsere Lebensgeschichte mit allem Auf und Ab, mit den prägenden positiven wie negativen Erfahrungen, mit dem, was uns nachhängt und einer Klärung bedürfte.
Das „Wenn ihr nicht umkehrt“ fordert uns heraus den Blick nach innen zu richten auf die eigene Befindlichkeit, das in Ordnung zu bringen, was in Unordnung geraten ist, das zu klären, was offen geblieben und noch zu bearbeiten ist. Das „Wenn ihr nicht umkehrt“ braucht Zeit, das sieht auch Jesus realistisch und lässt dafür die Zeit. Der Feigenbaum am Schluss des heutigen Evangeliums gibt diesen Eindruck wider. Obwohl er als Fruchtbaum keine Früchte trägt soll er für ein Jahr eine neue Chance bekommen. Vielleicht tut sich doch etwas mit Hilfe des Winzers. Der Weinbergarbeiter ergreift nochmals die Initiative mit der Absicht den Boden um den Feigenbaum herum aufgraben und düngen zu wollen. Der Feigenbaum bekommt also doch noch eine weitere Chance seiner Gattung und seinem Namen gerecht zu werden.
Wo muss der Winzer ansetzen? Was sollte er tun damit sich der Erfolg einstellt?
Vergangenes Jahr hatten wir in der Fastenzeit hier im Kirchenraum eine Ausstellung unter dem Leitwort: „Solidarisch“. Das Solidarischsein bezog sich auf ausgewählte stets präsente Problem- und Themenfelder, wie Krieg, Krankheit, Spannung von Reich und Arm, Klimakrise und Ökologie, die Themen Frauen und Kinder, Themenkreise, denen wir tagein, tagaus begegnen und die uns mehr oder weniger alle betreffen.
„Wo tut es weh? Überall, überall, überall“. Diese Worte stammen aus dem Kurzgedicht der britischen Dichterin Warsan Shire und beleuchteten tiefgehender diese Problemfelder. Der Wortlaut:
„Ich hielt einen Atlas auf meinem Schoß,
ließ meine Finger über die ganze Welt gleiten
und flüsterte wo tut es weh?
Sie antwortete überall, überall, überall“.
Wir haben eine Ahnung, ja wir wissen wo es weh tut, wo es sehr weh tut und schmerzt. Im globalen Kontext tut es immer vor unserer Haustür weh und auf uns persönlich bezogen gibt es ebenfalls Schmerzpunkte. Lassen wir das Gedicht persönlich auf uns bezogen sprechen:
Ich hielt einen Atlas auf meinem Schoß,
ließ meine Finger über meine Lebenswelt gleiten
und flüsterte wo tut es weh?
Sie – meine Lebenswelt – antwortete überall, überall, überall".
Ein Drittel der Fastenzeit liegt bereits hinter uns, zwei Drittel noch vor uns. Diese zwei Drittel bieten die Chance zur inneren Erneuerung und Stärkung, zur Ermutigung das in Ordnung zu bringen, was in Unordnung geraten ist, damit es eben nicht mehr so weh tut und unser Leben wie der Feigenbaum eine weitere Chance hat, neu Frucht zu bringen nach ertragloser Zeit. Alle Hilfen dürfen wir dazu annehmen. Der Winzer setzt am Wurzelwerk des Feigenbaumes an; er macht also eine Wurzelbehandlung und versucht von Grund auf dem Baum zu einem fruchtbringenden Ertrag zu verhelfen.
Wo tut es weh? Die Frage wird begleiten und hebt wohl das Empfinden der Unverhältnismäßigkeit nicht auf wie ich es anfangs an den Schilderungen der klagenden Frau erwähnt habe, warum das so und bei anderen wieder so ist. So ist es auch in meinem Leben; die Frage lenkt den Blick auf die Feigenfrucht meines Lebens, die reifen kann, wenn der innere Energiefluss die Kommunikation nach innen und nach außen befruchtet.