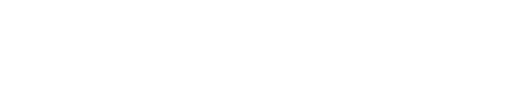Zusammen-gewürfelt
BuchBesuch in der Schmiede der Abtei Münsterschwarzach mit vielen Gästen.
Gerade noch haben die Stühle für die Besucherinnen und Besucher des BuchBesuchs unter dem Titel „Zusammengewürfelt“ gereicht – und das, obwohl der Weg zur Metallwerkstatt und Schmiede des Klosters nicht unbedingt selbsterklärend war und ein paar Nachzügler erst nach Umwegen die letzten Plätze besetzten. Umso schöner war es für Metallschmiedemeister Arnold Rumpel über seine Arbeit zu erzählen – immer wieder unterbrochen durch die einzigartige Musik des Traumpförtner-Trios mit Br. Julian Glienke OSB (Geige), Reinhard Kraft (Violine), Bruno Waldherr (Kontrabass) und Thomas Reuter (Akkordeon). „Wir Schmiede waren schon seit jeher ein hoch angesehenes und auch mystisches Handwerk“, erklärte er. Seit der Antike hafte diesem Beruf etwas Magisches an, konnten die Schmiede doch durch Feuer Metall zum Glühen und in neue Formen bringen. Der Feuergott Hephaistos – für die Schmiede ein geläufiger Name und sogar Titel der Fachzeitschrift – zeuge bis heute von dieser legendären Sicht auf das Schmiedehandwerk, denn der Schutzheilige der Schmiede, Eligius, habe eher weniger Bedeutung, so Rumpel.
Die gesamte Kulturgeschichte ist vom Handwerk der Schmiede durchzogen, wie Rumpel weiter erläuterte. In vielen Erzählungen, Legenden und Märchen seien es die Schmiede, die Erschaffer von Waffen und Schwertern wie etwa Excalibur waren. Von außen sei das Handwerk natürlich auch unverständlich gewesen. Dunkle, nur von Feuer erhellte Schmieden, in denen sich die Handwerker mit Klopfzeichen verständigten. Der Hintergrund: Damals gab es natürlich wenige technische Mittel, um etwa Bearbeitungstemperatur zu messen. Es musste anhand des Rot-Tons des glühenden Metalls erkannt werden. Und die Schmiedesprache über akustische Signale mit dem Hammer war aufgrund der Arbeitslautstärke auch eher von praktischem als von okkultem Hintergrund. Geheimnisvoll sei das Schmiedehandwerk allerdings immer gewesen.
Was auch eher rätselhaft schien, war seine Idee der Würfel. Zumindest zu Anfang. Anhand eines Erinnerungsstücks, ein einfacher Faden, den er immer bei sich tragen würde, ging er auf seinen persönlichen Hintergrund dazu ein. „Für mich war es wichtig, Stücke zu schaffen, die Geschichten erzählen. Für den einen ist es ein unscheinbarer Würfel, für den anderen hat er eine außergewöhnliche Bedeutung. Mich erinnert dieser Faden jeden Tag an einen für mich einzigartigen Moment einer Wanderung mit meiner Tochter zum Sonnenaufgang.“ Als er seine Idee im Jahr 2022 den anderen Handwerksbetrieben, der Schreinerei und der Gold- und Silberschmiede vorstellte, konnten die wenigsten seine Begeisterung teilen. Doch das änderte sich. Spätestens als P. Meinrad Dufner aus dem Kunstatelier an die Kreativität der Handwerker appellierte. Als die ersten Würfel aus unterschiedlichen Materialien gefertigt wurden. Als der Name „Zusammengewürfelt“ gefunden war. Als dann klar war: Wir machen das. Und als dann die einzelnen Würfel Geschichten bekamen.
Um Geschichten ging es auch P. Meinrad, der das Würfelprojekt als ganze Lebensphilosophie bezeichnete. „Zusammengewürfelt“ treffe auf so viele Bereiche zu, allein auf die bloße Existenz. „Denn wenn P. Christoph in seinen Vorträgen immer erklärt, dass wir alle aus Sternenstaub bestehen, dann sind wir, dann ist die Schöpfung, auch nur zusammengewürfelt – vor Millionen von Jahren.“ Und auch die eigenen Ahnen und Vorfahren, die Alemannen, eigentlich nur zufällig dort gelandet, denn diese seien bei der Völkerwanderung die „Fußlahmen“ gewesen.
Weiter kam er auf die unterschiedlichen Sprachen, die bei Fremdsprachenkenntnis auch ein Verstehen, ein Fühlen der anderen Kulturen beinhalten würden. Einzelne Worte, wie etwa „erinnern“, seien zusammengewürfelt und daher vielschichtig. „Er“ als etwas „er“fassendes, „er“lebendes und „in“ im „in“newerden, „in“nehalten. Das fordere aber auch eine Wahrnehmung, eine Sensibilität und Offenheit für die Umwelt. In der Kunstgeschichte zeige dieses bewusste Hinschauen auch eine Geschichte von Ausdrucksformen, einen Wandel. Und dieser wiederum bedingt die Historie von Erfindungen. „Wenn wir uns klarmachen, was von der Erfindung des Rades bis heute passiert ist – oder welche Entwicklung die Entdeckung des Hebelgesetzes bei den alten Ägyptern bedingt hat.“
Schließlich, so der Künstlerpater, sei auch das eigene Wesen zusammengewürfelt. Aus individuellen Empfindungen. Aus Bewusstem und Unbewusstem. Der eigene Schritt, die eigene Sprache, die eigen Angst. „Ich lebe aus unterschiedlichen Teilhaben und bin immer neuer Teil, neuer Anteilgeber.“ Eine Sichtweise, vielleicht eine Chance, eine Weisheit, die aber erkannt werden und eingeübt sein muss.
Und dann, der Würfel. Die Eins, einmalig, einzigartig, einsam. Die Zwei, eigentlich fast unspektakulär, aber das Gegenüber. Die Drei als Ich-Du-Wir, die aufgehobenen Gegensätze. Die Vier als paarweises Gruppengebilde. Die Fünf als die volle Hand, die zueinander und miteinander funktioniert – und die Sechs, weil der Würfel nun einmal sechs Seiten habe.
Zusammengewürfelt sei eben keine geordnete Zahlenfolge, sondern ein Zufall. Und eben nicht nur das Eine, sondern das Mehr. Die Vielfalt und das Spannungsfeld zwischen Ordnung und Unordnung. Die Fülle des Lebens. Aus allem etwas zu machen.